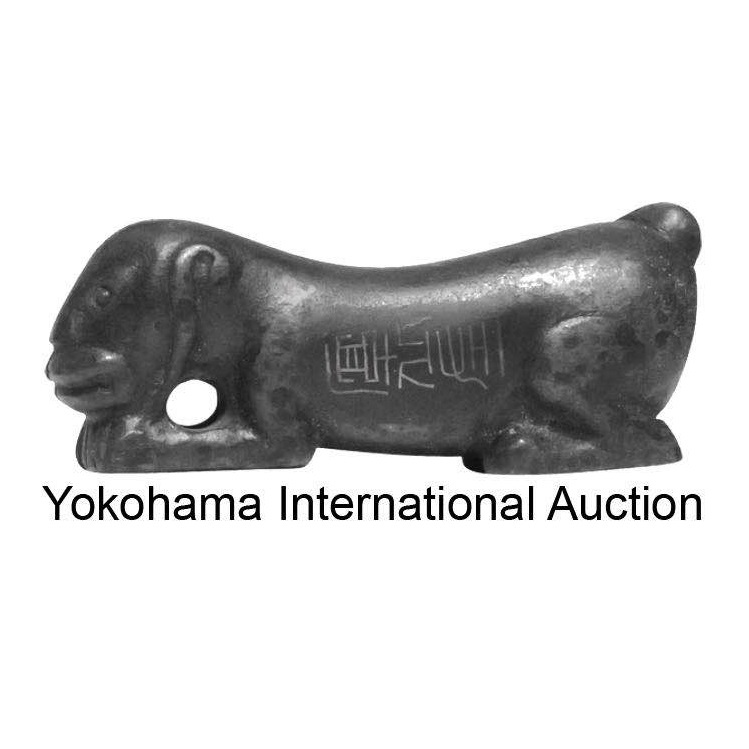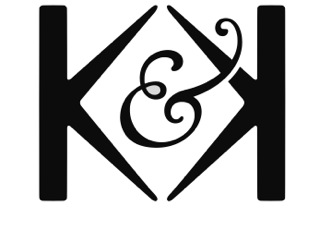| 作品描述 |
Otto Greiner
1869 Leipzig – 1916 München
Max Klinger
1857 Leipzig – 1920 Groß-Jena/Naumburg
Wern...
Otto Greiner
1869 Leipzig – 1916 München
Max Klinger
1857 Leipzig – 1920 Groß-Jena/Naumburg
Werner Teupser
1895 Leipzig – 1954 München
Die vorliegende Sammlung offenbart in Otto Greiner einmal mehr einen exzellenten Zeichner und Grafiker mit faszinierender Bildwelt und bewegter Biografie. Er erlebte die Jahrhundertwende um 1900 in seiner Geburtsstadt Leipzig, seinem Studienort München und seiner Wahlheimat Rom. Sein künstlerisches Schaffen hatte sein Fundament in einer lithografischen Ausbildung und wurde maßgeblich durch die Strömung des Symbolismus geprägt. Ganz im Sinne des Zeitgeistes schuf Greiner Monumentalgemälde, von denen nur wenige erhalten sind. Nach Erwerb im internationalen Auktionshandel kann die Staatsgalerie Stuttgart seit 2011 das Gemälde "Herkules bei Omphale" (1905) präsentieren. Greiners wohl eindrucksvollstes malerisches Werk hingegen, das in Rom entstandene und vom Museum der bildenden Künste in Leipzig erworbene Monumentalbild "Odysseus und die Sirenen" (1902), ging nach Auslagerung im Zweiten Weltkrieg verloren.
Umso glücklicher ist der Umstand, dass ein großer Teil seines grafischen Oeuvres erhalten blieb, nicht zuletzt durch die Verwaltung eines Teils des Greiner''schen Nachlasses durch den Leipziger Kunstverein sowie die Witwe des Künstlers Nannina Greiner in Rom.
Neben Lithografien von Greiners Hauptmotiven enthält die Offerte auch unikale Zeichnungen und Studien, die der Künstler in Vorarbeit seiner komplexen Kompositionen anfertigte und eine intensive Auseinandersetzung mit dem jeweiligen Sujet widerspiegeln.
Zentral für Greiners Werk ist die Stilisierung und Idealisierung des nackten, menschlichen Körpers. Detailliert beschäftigte er sich mit dessen Anatomie und Dynamik. Neben den Aktdarstellungen verdienen auch Greiners Porträts Beachtung, ebenso die Darstellungen der südlichen Landschaft, die ihn während seinen Jahren in Rom umgab.
Otto Greiner verarbeitete seine Eindrücke zu bildgewaltigen, allegorischen, religiösen und mythologischen Werken, wobei sich der Geschlechterkonflikt wie ein roter Faden durch sein Œuvre zieht. In unheilvoller, teils expliziter Erotik zeigt er die Frau oft als sündige Verführerin des Mannes. Deutlich wird dies insbesondere in Greiners einzigem Grafikzyklus "Vom Weibe" (1898–1900). Einige Motive dieser eindrucksvollen, aus fünf Blättern bestehenden Werkfolge finden sich in der vorliegenden Sammlung, darunter einzigartige Vorzeichnungen für die Lithografien "Der Teufel zeigt das Weib dem Volke" (1898) und "Golgatha" (1900). Das Kreuzigungsthema stellte Greiner in den Jahren um 1900 mehrfach in verschiedenen Kompositionen dar.
Stilistisch sind Parallelen zum Werk Max Klingers offensichtlich. Das im Museum der bildenden Künste ausgestellte Gemälde "Die Kreuzigung Christi" (1890), ein Hauptwerk Klingers, zeigt die thematisch große Überschneidung der beiden aus Leipzig stammenden Symbolisten. Nachdem sich Klinger und Greiner zu Beginn der 1890er Jahre in Rom begegnet waren, verband sie eine lebenslange Freundschaft. Die Tatsache, dass Greiner seinen Zyklus "Vom Weibe" Klinger widmete, zeugt von einer großen Wertschätzung des künstlerischen Schaffens seines Freundes. Eine Lehrer-Schüler-Beziehung wurde jedoch trotz der engen persönlichen Verbundenheit stets dementiert (Vgl. Julius Vogel, 1925, S. 39).
In der kunsthistorischen Wahrnehmung wurde Otto Greiner oft von Max Klinger überstrahlt, doch "[seine] große[n] Zeichnungen der späteren Jahre gehören zu den besten künstlerischen Leistungen und verdienen sogar vor denen Klingers den Vorzug" (zitiert nach Rolf Günther, 2005. S. 60).
Lit.:
Richard Hüttel, Bodo Pientka: Wahlverwandtschaften – Künstler um Max Klinger: Sammlung Bodo Pientka: Begleitbuch zur Ausstellung vom 3. Oktober bis 22. November 2020, Galerie im Schlösschen Naumburg (Saale). Naumburg 2020.
Rolf Günther: Traumdunkel. Der Symbolismus in Sachsen 1870 – 1920. Dresden 2005.
Birgit Götting: Otto Greiner: 1869 – 1916; die Entstehung eines Künstlers: zu den Aufstiegsbedingungen eines begabten Handwerkslithographen zu anerkannter Künstlergröße. 1980.
Secession – Europäische Kunst um die Jahrhundertwende. Ausstellungskatalog, Haus der Kunst München, 14. März bis 10. Mai 1964. München 1964.
Kunstchronik. Monatsschrift für Kunstwissenschaft, Museumswesen und Denkmalpflege, Jg. 7 Nr. 6 (1954). S. 170f.
Julius Vogel: Otto Greiner. Bielefeld / Leipzig 1925.
Leipziger Kunstverein (Hrsg.): Ausstellung zum Gedächtnis von Otto Greiner, gest. 24. September 1916. Leipzig 1917.
Julius Vogel: Otto Greiners graphische Arbeiten in Lithographie, Stich und Radierung. Dresden 1917.
Hans Singer: Otto Greiner – Meister der Zeichnung. Band 4, Leipzig 1912.
Julius Vogel: Otto Greiner. Leipzig 1903.
Otto Greiner
1869 Leipzig – 1916 München
Lithografenlehre im Verlag Julius Klinkhardt in Leipzig, erster Zeichenunterricht bei Arthur Haferkorn. 1888–91 Studium an der Kunstakademie München in der Malklasse von Alexander Liezen-Mayer. 1891 Reise nach Italien, wo er in Rom Max Klinger kennenlernte, mit welchem ihn eine lebenslange Freundschaft verband. Nach kürzeren Aufenthalten in Leipzig und München zog Greiner 1898 nach Rom und übernahm Klingers Atelier unweit des Kolosseums. In der italienischen Wahlheimat entstand ein Großteil seines künstlerischen Werks, hauptsächlich grafische Arbeiten. Heirat mit Nannina Duranti. 1915 Kriegseintritt Italiens, Flucht nach München. Auftrag für zwei Wandgemälde im Lesesaal der Deutschen Bücherei in Leipzig, die er jedoch krankheitsbedingt nie fertigstellen konnte. Starb 1916 an den Folgen einer Lungenentzündung.
Max Klinger
1857 Leipzig – 1920 Groß-Jena/Naumburg
Geboren als zweiter Sohn eines Seifensieders studierte er zunächst (nach versch. Empfehlungen) an der Großherzoglich Badischen Kunstschule in Karlsruhe. 1875 Fortsetzung der Ausbildung an der Berliner Akademie der Künste nach dem Vorbild Adolph Menzels. 1881 siedelte er nach Berlin über, wo er sein eigenes Atelier unterhielt. Mehrfach längere Aufenthalte in Brüssel, München, Paris und Rom. Klinger hatte bereits sehr früh großen Erfolg als Grafiker, u.a. mit dem Radierzyklus "Paraphrase über den Fund eines Handschuhs" (1881). Mit seinen Arbeiten "Beethoven", "Die neue Salome" und "Kassandra" gilt er als einer der wichtigsten Vertreter polychromer Plastik um 1900. Seine eigenwillige symbolische Bildsprache, besonders in den grafischen Arbeiten, machte ihn zu einem frühen Vorläufer des Surrealismus.
Werner Teupser
1895 Leipzig – 1954 München
Studium der Kunstgeschichte an der Universität Leipzig bei August Schmarsow, Rudolf Wackernagel, Adolf Goldschmidt und Wilhelm Pinder.1921 Promotion zum Thema "Die deutschrömische Landschaft vom Ende des 18. Jahrhunderts". Seinem Forschungsgebiet sollte Teupser zeitlebens treu bleiben, nachdem er bereits früh archäologische Studien in Italien betrieben hatte. 1923 wissenschaftlicher Mitarbeiter im Museum der bildenden Künste sowie künstlerischer Leiter und Bibliothekar des Leipziger Kunstvereins. 1929 Kustos und bald darauf Direktor des Museums. 1939 Geschäftsführer des Kunstvereins. Nachdem er 1945 aus allen Ämtern ausscheiden musste, war Teupser als freier Kunstschriftsteller tätig und verfasste u.a. Beiträge für die "Neue Deutsche Biografie". 1946 Cheflektor und Redakteur des Kunstverlags E. A. Seemann, der bis 1951 die "Zeitschrift für Kunst" herausgab. Umzug nach München zur Redaktion der Neuauflage des "Allgemeinen Lexikons der bildenden Künstler" von Thieme-Becker.
【作者】: Artist or Maker
Max Klinger
|
|---|
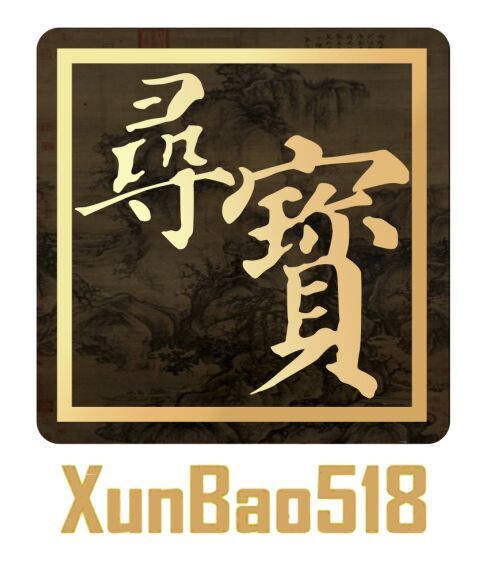 全球艺术品拍卖文献搜索鉴定平台
全球艺术品拍卖文献搜索鉴定平台